Vor welchen Herausforderungen steht unsere Erinnerungskultur? Im Wintersemester 2024/25 haben sich Studierende in einer Übung zur aktuellen Erinnerungskultur in Deutschland u. a. mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ihre Überlegungen zu den Problemen, Herausforderungen und Ideen für eine künftige Erinnerungskultur diskutierten einige Studierende am Ende des Semesters gemeinsam mit Ihrem Dozenten Prof. Dr. Henning Tümmers.
Carolin Mai: Herr Tümmers, Sie haben diese Übung zur aktuellen Gedenkkultur angeboten und sie „Hohle Rituale“ genannt. Was verstehen Sie unter „hohlen Ritualen“ bzw. was stimmt Ihrer Meinung nach mit der Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert nicht?
Henning Tümmers: Zunächst habe ich meine Lehrveranstaltung mit einem Fragezeichen im Titel versehen. „Hohle Rituale?“ greift im Grunde erst einmal eine Kritik an der „Erinnerungskultur“ auf, die seit ungefähr 2010 geäußert wird. Damals ging es vor allem darum, den „Abschied der Zeitgenossenschaft“ zu kompensieren. Gefordert wurde eine „Modernisierung“ der Erinnerungskultur, mit der man die Lücke schließen wollte, die durch das Sterben der Zeitzeug*innen entstand. Die Forderung nach einer Novellierung der „Erinnerungskultur“ hat sich neuerdings jedoch vor dem Hintergrund eines wachsenden Antisemitismus und eines erstarkten Rechtspopulismus massiv verstärkt. Expert*innen aus dem Gedenkstättenwesen und der Wissenschaft stellen seit 2023 vermehrt die Frage, wie funktionstüchtig eigentlich unsere „Erinnerungskultur“ noch ist. In diesem Kontext verstehe ich unter „hohlen Ritualen“ wiederkehrende Gedenkformen, die nicht mehr kritisch hinterfragt werden, sondern die man ausführt, weil man das im Grunde schon immer so gemacht hat. „Hohle Rituale“ erzielen meiner Meinung nach keine oder kaum eine Wirkung; sie unterliegen keiner kritischen Reflexion.
Was versteht ihr, die Seminarteilnehmer*innen, unter „hohlen Ritualen“, und was hat euch an der Übung angesprochen?
Tobias Lauer: Ich finde Gedenkstätten als ein mögliches Berufsfeld interessant. Ich habe ihre Arbeit grundsätzlich als sehr gut wahrgenommen und würde diese Meinung auch weiterhin vertreten. Trotzdem habe ich in letzter Zeit immer wieder hinterfragt, was Gedenkstättenarbeit wirklich bringt. Denn eine empirische Datenlage zu ihrem Nutzen fehlt, und es ist schwierig, konkret zu sagen, was Gedenkstättenarbeit noch erreichen kann.
Johannes Buck: Es existieren Formen des Gedenkens, die zur Routine wurden, etwa Ansprachen zu Jahrestagen im Bundestag. Es hat den Anschein, als wären diese Ansprachen ein Programmpunkt auf der Tagesordnung und danach geht es zurück zum Tagesgeschäft – etwa wie die Anwesenheitspflicht bei einer Vorlesung. Ansprechend an der Übung fand ich, dass sie auch einen gestalterischen Charakter hatte: Wir haben nicht nur die aktuelle Gedenkstättenkultur hinterfragt, sondern darüber hinaus könnte der Beitrag, den wir jetzt gerade produzieren, einen Anstoß zur Veränderung geben.
Nadine Roch: Ich habe mich für die Übung entschieden, weil ich die Proteste in Folge des 7. Oktobers [Angriff der Hamas auf Israel, Anm. CM] mitbekommen habe, ebenso wie den wachsenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Ich habe gemerkt, dass hier irgendwas einfach nicht funktioniert und mich das erste Mal gefragt: Wieso nicht? Ich dachte, vielleicht finde ich in der Übung Antworten. Klar ist: Formeln wie „Nie wieder ist jetzt“ werden inhaltslos, wenn keine Taten oder kein Engagement vonseiten der Politik folgt. Das verstehe ich unter dem Begriff „hohle Rituale“.
Henning Tümmers: Das „Nie wieder!“-Beispiel hätte ich auch als eine ritualisierte Verhaltensform definiert. „Nie wieder!“ stellt im Grunde nur eine Forderung dar, erklärt aber nichts und überfordert vielleicht manche Adressat*innen. Das „Nie wieder!“ stammt aus einer Zeit, in der die Erlebnisgeneration des Nationalsozialismus noch lebte , weshalb diese Botschaft vielleicht besser verfing als heute. Doch die Gesellschaft hat sich verändert. Eine bloße Forderung wie „Nie wieder ist jetzt“ kann nicht mehr für sich selbst stehen, sondern muss mit Konzepten, etwa zur Antisemitismus- oder Gewaltprävention, einhergehen.
Friederike Drellmann: Die Gruppierungen in unserer Gesellschaft haben sich verändert. Zwischen der Gegenwart und dem Nationalsozialismus liegt ein großer Zeitraum. Wir müssen selber überlegen und immer wieder neu aushandeln, wie wir mit der NS-Vergangenheit umgehen wollen, wie und was wir erinnern. Für mich war diese Übung ein erster Schritt dahin.
Welche Themen wurden im Seminar diskutiert?
Anton Mohr: In einem ersten Schritt haben wir Begriffe definiert. Was ist „Erinnern“? Was sind und machen „Gedenkstätten“? Was ist eine „Erinnerungskultur“? Und welche verschiedenen Arten des „Erinnerns“ existieren? Danach haben wir anhand verschiedener Fallbeispiele untersucht, wie Gedenkstätten aufgebaut sind, worin sie sich unterscheiden, wie sie arbeiten und was an ihren Konzepten vielleicht kritikwürdig ist.
Friederike Drellmann: Wir haben uns deutsche und internationale Gedenkstätten
angeschaut: Gedenkstätten, die den Nationalsozialismus thematisieren, ebenso wie Institutionen, die an 9/11, den Genozid in Ruanda oder die Verbrechen der DDR-Staatsführung erinnern. Dazu kamen
lokale Gedenkformen hier in Tübingen.
Henning Tümmers: Der Fokus lag auf Gedenkstätten, weil sie zentrale Orte eines politisch gestalteten und nationalen Gedenkens repräsentieren. Uns interessierte: Inwiefern lassen sich Gemeinsamkeiten identifizieren? Wie funktionieren Gedenkstätten? Folgen sie ähnlichen Mustern?
Was habt ihr anhand der Referate zu verschiedenen Gedenkstätten beobachtet? Existieren Auffälligkeiten oder Gemeinsamkeiten?
Felix Gogollok: Wir konnten vor allem beobachten, dass Gedenkstätten als zentrale Orte, an denen nationales Gedenken inszeniert wird, bestimmte politische Ziele verfolgen. Teilweise werden sie sogar, so wie in Ruanda/Kigali, zu politischen Zwecken instrumentalisiert.
Tobias Lauer: Das ist tatsächlich aber keine Besonderheit des Kigali Genozid Memorial. Im Laufe der Übung wurde deutlich, dass eigentlich alle Gedenkstätten eine politische Zielsetzung haben – auch in Deutschland. Wir berufen uns darauf, „Erinnerungsweltmeister“ zu sein. Aber auch hier haben Gedenkstätten einen politischen Hintergrund. Im Rahmen der Wiedervereinigung 1989/90 versuchte die Bundespolitik, internationale Sorgen vor einem Wiedererstarken Deutschlands zu entkräften. Daraus folgten intensive Bemühungen, die Erinnerungskultur entsprechend zu gestalten. Das spricht dafür, dass Deutschland seine Vergangenheit ein Stück weit nach außen hin positiv aufarbeiten wollte.
Nadine Roch: Das zeigt sich auch beim Denkmal für die ermordeten Juden in Berlin, weil es prominent mitten in der Hauptstadt steht. Es ist ein sehr großes Denkmal, an dem man eigentlich nicht vorbeikommt.
Henning Tümmers: Sämtliche Fallbeispiele von Gedenkstätten, die wir betrachtet haben, transportieren politische Botschaften. In Berlin dient, wie schon gesagt wurde, das Mahnmal der Selbstdarstellung. In Ruanda ist es anders: Das Kigali Genocide Memorial versucht, den Genozid in einen Kontext zu anderen Genoziden zu stellen. Die Verantwortlichen wollen sagen, dass Genozide kein Alleinstellungsmerkmal für Ruanda darstellen, das heißt, dass sie auch woanders vorkommen. So werden etwa Bezüge zum Holocaust geknüpft. Gleichzeitig nutzen die Verantwortlichen diese Ausstellung, um klarzumachen, dass die Kolonialzeit großen Einfluss darauf hatte, dass die lokale Gesellschaft sich schon vor dem 20. Jahrhundert gespalten hatte und Konflikte entstanden waren. Eine politische Aufladung kann man zudem in den USA sehen. Das United States Holocaust Memorial Museum ist stolz darauf, dass es die USA und die US-Truppen waren, die einige Konzentrationslager in Deutschland befreiten. Das Memorial Museum präsentiert eine Art Leistungsschau der USA. Dieser Nationalstolz und dieses Pathetische fanden wir aber auch im 9/11-Memorial.
Anton Mohr: Gedenken und Gedenkstätten sind immer unfassbar politisch, weil die Entscheidung, an „etwas“ oder „jemanden“ zu erinnern oder zu gedenken, höchst politisch ist. Das sieht man auch an der Entwicklung des Gedenkens in der Bundesrepublik, aber zum Beispiel in Srebrenica ganz aktuell. Dort gibt es Gruppen und Gruppierungen, die den Genozid nicht erinnern wollen, weil sie ihn nicht als Genozid anerkennen.
Maren Brugger: In Deutschland lässt sich beobachten, dass manche Opfergruppen erst nach und nach in das Bewusstsein von Politik und Gesellschaft gerückt sind. Ich meine die verfolgten Homosexuellen, die ermordeten Sinti*zze und Rom*nja und die sogenannten Euthanasieopfer. Diese Gedenkstätten sind erst im Nachgang des Holocaust-Mahnmals entstanden. Sie sind zwar auch zentral gelegen, aber weitaus unscheinbarer.
Johannes Buck: Ich habe über das United States Holocaust Memorial Museum in Washington referiert. Dessen Entstehungsgeschichte war auch schon sehr vielschichtig und politisch. Beispielsweise ging der Antragsstellung voraus, dass Präsident Carter innerhalb der jüdischen Gemeinschaft nur geringes Ansehen genoss. Das schien sich zu ändern, als Carter den Plan zum Bau des USHMM bekannt gab. Jedenfalls war der israelische Botschafter anwesend. Parallel dazu versuchte die Kohl-Regierung, auf die Gestaltung des Memorials einzuwirken, denn sie befürchtete, dass dadurch eine antideutsche Stimmung entstehen könnte. Die politische Strahlkraft reicht bei diesem Beispiel also über Ländergrenzen hinaus.
Henning Tümmers: Auf der einen Seite haben wir es also mit Gedenkstätten zu tun, die an den realen Tatorten der Verbrechen errichtet wurden. Auf der anderen Seite existieren Memorial-Museums wie in den USA, die keinen Bezug zu den Orten der Verbrechen haben. Aber dennoch funktionieren die Gedenkstätten oder Museen ähnlich, nämlich als eine Art künstlicher Nachbau, als ein Erfahrungsraum des Leids, der Gewalt und der Verbrechen. Eine weitere Gemeinsamkeit der Gedenkstätten oder Memorials besteht darin, dass sie zu Teilen ähnlich aufgebaut sind. Sie alle haben einen konkreten Ort, der der Erinnerung und des Gedenkens dient. Wir haben eine Hall of Names in den USA, einen Raum der Namen in Berlin. Und zuletzt: Was alle Gedenkstätten eint, ist eine starke Opferzentrierung.
Anton Mohr: Ich habe das Gefühl, dass manche Gedenkstätten vor allem darauf zielen, dass man betroffen ist. Aber darüber hinaus passiert wenig.
Friederike Drellmann: Möglicherweise ist das auf die Entstehungsgeschichte der Gedenkstätten zurückzuführen. Diese sind in Westdeutschland nach 1945 durch private Initiativen entstanden. Das Ziel bestand darin, die grausame Vergangenheit zu dokumentieren. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass es keinen wirklichen Kriterienkatalog für Gedenkstätten gibt. Scheinbar existieren keine genauen Vorgaben darüber, was eine Gedenkstätte leisten soll und wie sie das umsetzten kann.
Tobias Lauer: Gedenkstätten stehen derzeit vor großen Herausforderungen. Gedenken, so wie es vor ein paar Jahrzehnten eingeführt und praktiziert wurde, ist heute oft nicht mehr zeitgemäß. Die Konzepte entsprechen vielleicht auch nicht mehr den aktuellen wissenschaftlichen Standards. Gleichzeitig wurden diese Konzepte in einer Zeit entwickelt, in der das Gedenken an den Nationalsozialismus in der westdeutschen Gesellschaft noch durchaus auf Widerstand stieß. Die Leistung der frühen Konzepte sollte also anerkannt werden. Gerechtfertigt ist gleichzeitig aber auch die aktuelle Kritik an der Emotionalisierung von Besucher*innen. Es dürfte schwierig werden, einen Weg zu finden, der sowohl Akteur*innen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen zufrieden stellt.
Maren Brugger: Eine weitere Gemeinsamkeit ist ein Phänomen, das man „western memorial politics“ nennen könnte: Das Konzept der Gedenkstätte in Ruanda entspricht stark dem „westlichen“ Konzept der KZ-Gedenkstätten in Deutschland und des USHMM in Washington, auch wenn sie unterschiedliche politische Intentionen verfolgen mögen. Eine Auffälligkeit, über die wir in der Übung gesprochen haben, ist das Ergebnis empirischer Studien, die nach der Wirkung solcher Besuche fragen. Wenn wir diesen Studien Glauben schenken, dann ist die Wirkung eher gering. Eine Gefahr besteht darin, durch die Sakralisierung des Ortes und durch eine starke Emotionalisierung von Besucher*innen Gedenkstättenbesuche selbst zu einem hohlen Ritual zu werden.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Problemen der Herausforderungen der aktuellen Erinnerungskultur? Lesen Sie hier Teil 2 des Interviews: „Hohle Rituale? Verbrechen erinnern im 21. Jahrhundert“ – Teil 2: Unrecht durchdenken statt gedenken.
Tübingen, 12.2.2025
Ein Interview von Carolin Mai
Im Interview haben Maren Brugger, Johannes Buck, Friederike Drellmann, Felix Gogollok, Tobias Lauer, Anton Mohr, Nadine Roch, Malte Rong und Prof. Dr. Henning Tümmers diskutiert.
Weiterführende Literatur zum Thema:
Doron Bar: Yad Vashem. The Challenge of Shaping a Holocaust Remembrance Site 1942-1976, Berlin, Boston 2022.
Ger Duijzings: Commemorating Srebrenica. Histories of Violence and the Politics of Memory in Eastern Bosnia. In: Xavier Bougarel/Elissa Helms/Ger Duijzings (Hrsg.): The New Bosnian Mosaic. Identities, Memories and Moral Claims in a Post-War Society, Hampshire, UK 2007, S. 141-166.
Peter Erler: Vom zentralen „Stasi-Knast“ zum bedeutendsten Erinnerungsort der zweiten deutschen Diktatur. In: Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat 41 (2017), S. 59-76.
Iris Groschek / Habbo Knoch (Hrsg.): Digital Memory. Neue Perspektiven für die Erinnerungsarbeit, Göttingen 2023.
Gabriele Hammermann: Die KZ-Gedenkstätte Dachau – Zukunft der Erinnerung. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 72 (2021), Heft 3/4, S. 125-144.
Jan-Holger Kirsch: Nationaler Mythos oder historische Trauer? Der Streit um ein zentrales „Holocaust-Mahnmal“ für die Berliner Republik, Köln u.a. 2003.
Volkhard Knigge (Hrsg.): Jenseits der Erinnerung - Verbrechensgeschichte begreifen. Impulse für die kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nach dem Ende der Zeitgenossenschaft, Göttingen 2022.
Habbo Knoch: Geschichte in Gedenkstätten. Theorie- Praxis - Berufsfelder, Tübingen 2020.
Lester J. Levine: 9/11 Memorial Visions. Innovative Concepts from the 2003 World Trade Center Site Memorial Competition, North Carolina 2016.
A. Dirk Moses: Der Katechismus der Deutschen. In: Geschichte der Gegenwart (2021), URL: https://geschichtedergegenwart.ch/der-katechismus-der-deutschen/ (18.5.2025).
Kathrin Pieper: Die Musealisierung des Holocaust. Das Jüdische Museum in Berlin und das United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. – ein Vergleich, Köln, Weimar, Wien 2006.
Amy Sodaro: Exhibiting Atrocity. Memorial Museums and the Politics of Past Violence, New Brunswick, New Jersey 2018, S. 84-110.
Harald Welzer: Für eine Modernisierung der Erinnerungs- und Gedenkkultur. In: Gedenkstättenrundbrief 162 (08/2011), S. 3-9.
Infospalte
Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Professoren im Zwielicht? Studentische Auseinander-setzung mit der NS-Vergangenheit
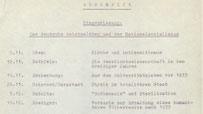
Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Blogreihe: „Zwischen Verdrängen und Erinnern: Tübingens Umgang mit dem Nationalsozialismus“
Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Akteure der Anatomie-geschichte. Die „Entgrenzte Anatomie" rezensiert
Kennen Sie schon... ?
Die Welt in Württemberg? Das Untere Schlossportal von Schloss Hohentübingen
Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Verwandte Themen:









Kommentar schreiben