Hier geht es zu Teil 1 dieses Beitrags: Glokale Botanik 1: Leonhart Fuchs und der Botanische Garten
Mit ihrem Botanischen Garten ist die Universität Tübingen im Besitz einer Lebendsammlung heimischer und global zusammengetragener Pflanzen, deren Akquise bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht – und ist damit nicht alleine. Mit den europäischen „Entdeckungsfahrten“ begann eine lange Geschichte europäischer Aneignung von Botanik. Europäische Gelehrte wie Leonhart Fuchs (1501–1566) in Tübingen und Ulisse Aldrovandi (1522–1605) in Bologna begannen, Naturalien systematisch zu verzeichnen und zu sammeln. Über Pflanzentransfers, Klassifikationen und Züchtungen wurden die Gärten, wie ihre Universitäten, zu Akteuren eines botanischen Imperialismus.
Pflanzensammlungen werden bereits seit Tausenden von Jahren angelegt, aber erst im 16. Jahrhundert wurde die Suche nach neuen Spezies systematisch und wissenschaftlich betrieben. Im Kielwasser der seefahrenden „Entdecker“ kamen Botaniker mit in „neue“ Länder und sammelten auf diesen Fahrten ausgiebig für die britischen, portugiesischen und italienischen Universitäten und die adelige Oberschicht.[1] Parallel dazu entwickelten sich erste universitäre Lehrgärten als Teil der medizinischen Forschung. Aus dieser Richtung kam der Tübinger Medizinprofessor Leonhart Fuchs, der sich in seinem hortus medicus am Nonnenhaus hauptsächlich auf heimische und Arzneipflanzen konzentrierte.
Doch das Phänomen eines universitären Lehrgartens ist nicht einzigartig um diese Zeit. Italienische Städte wie Pisa, Padua und Bologna legten um die gleiche Zeit ihre ersten botanischen Gärten an, zogen ebenfalls neuartiges Gemüse aus gehandelten Samen heran und profitierten als Teil des Netzwerkes der frühen „Entdeckungsreisen“ und der Erschließung von Handelswegen durch Asien. Als ältester botanischer Garten gilt derjenige von Pisa aus dem Jahr 1543, kurz darauf folgte der Garten von Padua (1545).[2] Beide Städte zogen einen Vorteil aus ihrer Hafenanbindung, die sie zum Drehkreuz für die Einführung und das Studium mitgebrachter Pflanzen machten - zum ersten Mal wurzelten hier auf europäischem Boden Flieder, Sonnenblumen und Kartoffeln[3] – und zum Umschlagplatz für die Verbreitung von Pflanzen und Erkenntnissen.

In der im Landesinneren liegenden italienischen Universitätsstadt Bologna war Ulisse Aldrovandi (1522–1605) (Abb. 1) treibende Kraft hinter der dortigen botanischen Sammlung. Als Philosophie- und Medizinprofessor konzentrierte er sich zunächst auf Heilpflanzen, sammelte diese selbst in der Region Emilia-Romagna und folgte dem Vorbild Fuchs’, indem er seine teils lebendige Sammlung ebenfalls mit kolorierten Bildtafeln katalogisierte.[4] Neben der Anlage eines hortus vivus in Bologna (1567) übernahm Aldrovandi die damals pionierhafte Abbildungstechnik über Holzschnittdrucke, um seine Forschungen festzuhalten.[5] Dabei war er sich bereits der Bedeutung naturalistischer Abbildungen für die Verbreitung und den Austausch von Wissen bewusst.[6] Um die 3936 Holzschnitte dürfte er beauftragt haben – manche sind nur bemalt, aber noch nicht ausgeschnitzt erhalten. Mit ihnen publizierte er zu Lebzeiten 13 illustrierte Bücher über Naturgeschichte.[7] Damit ging er jedoch noch mehrere Schritte über das Kreüterbuch seines Kollegen hinaus: Nicht nur Pflanzen, auch Tiere fasste er auf Holztafeln und Buchseiten. Die Abbildungen waren nicht nur bildliche Sammlung, sondern auch Ordnungssystem – für die materiellen Objekte in seinem eigenen Besitz sowie für eine allgemeine botanische und zoologische Lehre.[8] Aldrovandis Sammlung war nach der scala naturae (Stufenleiter der Natur), einer bereits in der Antike angewendeten Klassifizierung von Aristoteles, von Pflanzen zu Tieren und von einfachen zu komplexen Wesen geordnet.[9]
Aldrovandis Herbarium: Wissen und Pflanzen, weit gereist
Man könnte von einer Trias der Lehrgärten im 16. Jahrhundert sprechen. Zu botanischen Gärten und ihren Abbildungen auf Buchseiten kam eine neue Technik der Sammlung und Konservierung hinzu: Der hortus siccus (Trockengarten). Die Idee, Pflanzen(-teile) und Samen in getrockneter Form zu konservieren, zu ordnen und zu Lehrzwecken zu verwenden, breitete sich über die botanische Lehre in Padua aus,[10] wo auch Aldrovandi studierte. Im Laufe von 35 Jahren legte er ein eigenes Herbarium an, das mit ursprünglich über 5.000 Pflanzenarten die zu dieser Zeit umfangreichste Sammlung Europas war. Es enthielt Pflanzen aus Europa und Asien, vom Nahen Osten bis Indien, sowie aus Mittel- und Südamerika. Der Großteil entstammte aber der unmittelbaren Nähe Bolognas, nachvollziehbar durch detaillierte Verweise auf die Herkunft und Fundorte der Pflanzen – eine Sammel- und Arbeitspraxis wie bei Fuchs, die beider Werke zu einer Seltenheit der damaligen Naturforschung macht.[11] Wie als Gegenstück zu Fuchs’ Kreüterbuch konzipiert, enthält das Herbarium die ersten echten Exemplare vieler in Italien bislang fremder Arten wie Tabak, Mais und Kürbis, aber auch Steckrübe und Kohl.[12]
Wie kamen diese Spezies zu Aldrovandi? Aus seiner Korrespondenz entfaltet sich das Bild eines umfassenden transnationalen Netzwerkes. Er stand im Austausch mit 446 Gelehrten, Ärzten, Humanisten, Politikern und Adligen, die alle einen logistischen, akademischen oder finanziellen Anteil an seiner Forschung hatten. Über 50 Jahre lange schickten ihm seine Korrespondenten Muster neuer Pflanzen (ob getrocknet oder lebend), Tierskelette oder Bücher.[13]
Wie es die genannten Gemüsesorten bereits andeuten, wurden in Italien auch Pflanzenzüchtungen von nördlich der Alpen übernommen. Aldrovandis Herbarium zeigt z.B. eine getrocknete Kohlart, die aus dem botanischen Garten Paduas stammt und dort aus Samen gekeimt wurde, welche ursprünglich aus Deutschland kamen.[14] Wie die Pflanzenarten so zirkulierte auch das Wissen. Obwohl es offenbar keine direkte Korrespondenz zwischen Aldrovandi und Fuchs gab, stand Aldrovandi im Austausch mit deutschen Gelehrten und wurde von Fuchs nachhaltig beeinflusst. Er orientierte sich nicht nur am Kreüterbuch als Beispiel für Illustrationen, sondern übernahm auch Fuchs’ Beschriftungspraxis und einige seiner Namensgebungen.[15] Gleichzeitig war er selbst nicht zurückhaltend mit seinem Wissen, sondern teilte seine Erkenntnisse und Exemplare ebenfalls mit dem Netzwerk an Gelehrten, Sammlern und Reisenden, was für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich war.[16]
Die „andere Renaissance“[17] – Botanik, Zoologie… Ethnographie?
Aldrovandi legte über sein Herbarium hinaus eines der ersten Naturalienkabinette an, das im Laufe des 16. Jahrhunderts zum größten in ganz Europa werden sollte.[18] Nach dem Prinzip der neuzeitlichen „Wunderkammern“ war ein Naturalienkabinett eine Sammlung besonders wertvoller, seltener und prestigeträchtiger, aber auch zu erforschender Flora und Fauna. Diese waren für die Gelehrten nicht nur Ausstellungsobjekte, sondern Ausdruck und Instrument eines neuen Erkenntnisdrangs über die Natur, wie ihn auch Leonhart Fuchs in Rückbesinnung auf die antiken Lehren beschäftigte.[19] Aldrovandi begriff seine Sammlung und ihre Präsentation in seinen Privaträumen bereits als Museum[20] und Ort der experimentellen Forschung. Natur wurde darin nun zum greifbaren Objekt der Wissenschaft,[21] und Aldrovandi selbst hielt fest, er forsche über Dinge, die er Stück für Stück in seiner kleinen Welt der Natur aufbewahrt habe, so dass jeder sie täglich sehen und eingehend betrachten könne.[22] Genauso sollte sein Museum allen Gelehrten zugänglich sein, um sich vergewissern zu können, dass die Beschreibungen in seinen Büchern korrekt waren.[23]

Diese Art der Erforschung lässt sich neben den botanischen und zoologischen Arten und Exponaten auch noch auf eine dritte Komponente in Aldrovandis Naturalienkabinett beziehen: Aus der „Neuen Welt“ ging ihm auch materielle Kultur zu, weswegen bis heute u. a. eine aztekische Maske, zwei Dolchgriffe und mesoamerikanische Federarbeiten zu seiner Sammlung gehören.[24] Auf der einen Seite wird aus seinen Abhandlungen in erster Linie allein durch seine Zuordnung aller Steinarbeiten zu den Mineralien ein taxonomisches Interesse an den Objekten deutlich. [25] Auf der anderen Seite erkannte er die Kunstfertigkeit der Arbeiten an. Seine humanistischen Beschreibungen und Informationen über die dortige indigene Kultur trugen später dazu bei, die Bevölkerung Mesoamerikas als „missionierbar“ zu bewerten.[26]
1603 vermachte Aldrovandi seine Sammlung, seine Tafeln und seine fast 400 Manuskripte dem Senat von Bologna, damit sie weitergeführt und gepflegt werde und weiterhin Gelehrten zugänglich bliebe. Heute schätzt man sie nicht nur als Zeugnis einer „anderen Renaissance“ und als Ausgangspunkt moderner Naturwissenschaften, sondern jüngst auch als potentielle Quelle zu indigenem Wissenstransfer in der europäischen Wissensgeschichte zu Amerika.[27]
Ein Beitrag von Vera Brillowski
Fußnoten:
[1] Vgl. Broswimmer, Franz: Botanical Imperialism. The Stewardship of Plant Genetic Resources in the Third World, in: Critical Sociology 18 (1991), 1, S. 3–17, S. 7 und Findlen, Paula: Die Zeit vor dem Laboratorium. Die Museen und der Bereich der Wissenschaft 1550–1750, in: Grote, Andreas (Hg.): Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, Wiesbaden 1994, S. 191–207, S. 191.
[2] Vgl. Dobat, Klaus: Ein blühendes Forschungsfeld. Der Fuchs’sche Garten beim Nonnenhaus, in: Brinkhus, Gerd; Pachnicke, Claudine (Hg.): Leonhart Fuchs (1501–1566). Mediziner und Botaniker, Tübingen 2001, S. 113–120, S. 119.
[3] Vgl. Comune di Padova: Orto Botanico di Padova, online: https://www.comune.padova.it/vivere-il-comune/luoghi/orto-botanico (27.07.2025).
[4] Vgl. Buldrini, Fabrizio u.a.: L’erbario di Ulisse Aldrovandi. Attualità di una collezione rinascimentale di piante secche, in: Aldrovandiana 2 (2023) 1, S. 7–34, S. 10.
[5] Vgl. ebd.
[6] Vgl. Carrada, Giovanni u.a.: The other Renaissance. Ulisse Aldrovandi and the wonders of the world, Bologna 2022, Audioguide zur Ausstellung vom 08.12.2022 bis 28.05.2023, online: https://www.spreaker.com/episode/the-other-renaissance-ulisse-aldrovandi-and-the-wonders-of-the-world--52069452?key=sd7mFsFQq7dT--52069452 (27.07.2025).
[7] Vgl. ebd.
[8] Vgl. MacGregor, Arthur: Die besonderen Eigenschaften der „Kunstkammer“, in: Grote, Andreas (Hg.): Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, Wiesbaden 1994, S. 61–106, S. 84.
[9] Vgl. Carrada: The other Renaissance, 2022.
[10] Vgl. Università di degli Studi di Padova: Gli erbari secchi, online: https://mostre.cab.unipd.it/illustrazione-botanica/it/7/herbaria-of-dried-plants (27.07.2025).
[11] Vgl. Buldrini: L’erbario, S. 12f.
[12] Vgl. ebd., S. 14.
[13] Vgl. ebd., S. 8.
[14] Vgl. Buldrini: L’erbario, S. 26.
[15] Vgl. ebd., S. 10.
[16] Vgl. Palmer, Richard: Medical Botany in northern Italy in the Renaissance, in: Journal of the Royal Society of Medicine, 78 (1985) 2, S. 149–157, S. 149.
[17] Titel einer Ausstellung der Sammlung von Ulisse Aldrovandi in Bologna, vom 08.12.2022 bis zum 25.05.2023.
[18] Vgl. Carrada: The other Renaissance, 2022.
[19] Vgl. Teil 1 dieses Beitrags: Leonhart Fuchs und der Botanische Garten, URL: https://www.historischer-augenblick.de/glokale-botanik-fuchs/ (27.7.2025).
[20] Vgl. Buldrini: L’erbario, S. 8.
[21] Vgl. Findlen: Laboratorium, S. 192.
[22] Vgl. ebd., S. 197.
[23] Vgl. Olmi, Guiseppe: Die Sammlung – Nutzbarmachung und Funktion, in: Grote, Andreas (Hg.): Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, Wiesbaden 1994, S. 169–189, S. 175.
[24] Vgl. Domenici; Carrada: The other Renaissance, 2022 und siehe Domenici, Davide: Ulisse Aldrovandi and Indigenous American Featherwork, in: Aldrovandiana 3 (2024) 2, S. 7–39.
[25] Vgl. Domenici, Davide: Rediscovery of a Mesoamerican greenstone sculpture from the collection of Ulisse Aldrovandi, in: Journal of the History of Collections 34 (2022) 1, S. 1–21, S. 1 und 14.
[26] Vgl. Domenici; Carrada: The other Renaissance, 2022.
[27] Vgl. Domenici, Davide: Ulisse Aldrovandi and Indigenous American Featherwork, in: Aldrovandiana 3 (2024) 2, S. 7–39, S. 39.
Literatur:
Broswimmer, Franz: Botanical Imperialism. The Stewardship of Plant Genetic Resources in the Third World, in: Critical Sociology 18 (1991), 1, S. 3–17.
Buldrini, Fabrizio u.a.: L’erbario di Ulisse Aldrovandi. Attualità di una collezione rinascimentale di piante secche, in: Aldrovandiana 2 (2023) 1, S. 7–34.
Dobat, Klaus: Ein blühendes Forschungsfeld. Der Fuchs’sche Garten beim Nonnenhaus, in: Brinkhus, Gerd; Pachnicke, Claudine (Hg.): Leonhart Fuchs (1501–1566). Mediziner und Botaniker, Tübingen 2001, S. 113–120.
Carrada, Giovanni u.a.: The other Renaissance. Ulisse Aldrovandi and the wonders of the world, Bologna 2022, Audioguide zur Ausstellung vom 08.12.2022 bis 28.05.2023, online: https://www.spreaker.com/episode/the-other-renaissance-ulisse-aldrovandi-and-the-wonders-of-the-world--52069452?key=sd7mFsFQq7dT--52069452 (27.07.2025).
Domenici, Davide: Rediscovery of a Mesoamerican greenstone sculpture from the collection of Ulisse Aldrovandi, in: Journal of the History of Collections 34 (2022) 1, S. 1–21.
Domenici, Davide: Ulisse Aldrovandi and Indigenous American Featherwork, in: Aldrovandiana 3 (2024) 2, S. 7–39.
Findlen, Paula: Die Zeit vor dem Laboratorium. Die Museen und der Bereich der Wissenschaft 1550–1750, in: Grote, Andreas (Hg.): Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, Wiesbaden 1994, S. 191–207.
MacGregor, Arthur: Die besonderen Eigenschaften der „Kunstkammer“, in: Grote, Andreas (Hg.): Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, Wiesbaden 1994, S. 61–106, S. 84.
Palmer, Richard: Medical Botany in northern Italy in the Renaissance, in: Journal of the Royal Society of Medicine, 78 (1985) 2, S. 149–157.
Università di degli Studi di Padova: Gli erbari secchi, online: https://mostre.cab.unipd.it/illustrazione-botanica/it/7/herbaria-of-dried-plants (27.07.2025).
Bilder:
*Abb. 1: Naturforscher Ulisse Aldrovandi (1522–1605), Bild: Attributed to Agostino Carracci, Public domain, via Wikimedia Commons.
** Abb. 2: Museum der Sammlung Aldrovandi im Palazzo Poggi, Bologna, 2016. Bild: Palickap, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons.
Infospalte
Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?
Professoren im Zwielicht? Studentische Auseinander-setzung mit der NS-Vergangenheit
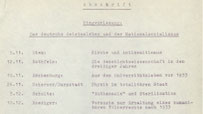
Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Blogreihe: „Zwischen Verdrängen und Erinnern: Tübingens Umgang mit dem Nationalsozialismus“
Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Akteure der Anatomie-geschichte. Die „Entgrenzte Anatomie" rezensiert
Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Verwandte Themen:


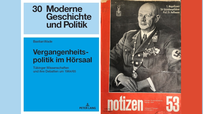




Kommentar schreiben