
Tübingen am 18. April 1945, mitten in der Nacht. Angeblich sollten die Sprengsätze schon in der Eberhardsbrücke gesteckt haben, um mit der Sprengung den von Norden anrückenden Franzosen des Combat Command V den Weg auf die Alb zu erschweren. Alle anderen verkehrstüchtigen Neckarbrücken waren auf Befehl aus Stuttgart bereits in die Luft gejagt worden. Eine kleine Pionierabteilung – die Angaben rangieren zwischen vier und zehn – war für die Sprengung zuständig. Aber dazu kam es nie: Weil Tübingen keinen Widerstand leistete, wurden die Häuser in direkter Nachbarschaft von einer Explosion verschont; auch ein befürchtetes Blutbad in den Tübinger Lazaretten blieb aus.[1] Der ehemalige Oberstudiendirektor Wilhelm Bosch in Seebronn (bei Rottenburg) hatte den französischen Befehlshabern bereits in Aussicht gestellt, dass Tübingen sich kampflos ergeben würde.[2] Vermutlich wäre die Zerstörung der letzten Brücke über den Neckar auch als Wortbruch verstanden worden und hätte die Zerstörung ganz Tübingens bedeuten können. Doch weshalb wurde die Brücke trotz des Befehls und der sich vor Ort befindenden Pionierabteilung schließlich nicht gesprengt?
Szenario 1: Verhinderte Dr. Dobler durch eine Entwaffnung des Sprengkommados die Sprengung?
Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, weshalb die erst 1901 erneuerte Eberhardsbrücke doch nicht gesprengt wurde. Diese Unübersichtlichkeit hat auch dazu geführt, dass in der regionalhistorischen Literatur sehr unterschiedliche Versionen des Ereignisses kursieren. Grundlage für das erste Szenario war ein Augenzeugenbericht (ohne Angabe des Zeugen) im neu gegründeten schwäbischen Tagblatt. Demzufolge habe der diensthabende Standortarzt Dr. Dobler die Stadt schon seit mehreren Tagen vor der Zerstörung zu retten geplant, indem er den letzten Befehlen der Verteidigung Tübingens Widerstand leistete. Ob er persönlich den Auftrag an drei seiner Unterstützer – sein Adjutant Hauptmann Sigel, der Oberleutnant Ulmer und der Unteroffizier Schneck – gab, zur Neckarbrücke in der Nacht der geplanten Sprengung zu eilen, oder sie auf Eigeninitiative (ohne Dr. Dobler) anrückten, geht aus dem Artikel nicht hervor. Ulmer und Schneck sollen die namentlich nicht genannte Pionierabteilung mit gezogener Pistole entwaffnet und zunächst von der Sprengung abgehalten haben. Die Heldennarration dieser Geschichte liegt in der Bedrohung durch Verhaftung, vor der Dr. Dobler den Unteroffizier Schulz bewahrte:
Der Offizier erklärt sich Oblt. Ulmer gegenüber als Vorgesetzter und verlangt von ihm die Personalunterlagen mit der Bemerkung: „Mit solchen Leuten wie Sie wird heute Gott sei Dank kurzer Prozeß gemacht.“ Er befiehlt dem Oberfeldwebel, dafür zu sorgen, daß Oblt. Ulmer seinen augenblicklichen Platz nicht zu verlassen habe und erklärte, Oblt. Ulmer in kurzer Zeit zur Vernehmung abholen zu lassen. Daraufhin wendet der PRW. an der Neckarbrücke und fährt zurück. Durch einen glücklichen Zufall kommt im gleichen Augenblick Oberfeldarzt Dobler mit seinem Wagen zurück, hält und befiehlt Oblt. Ulmer, einzusteigen. In der Meinung, daß es sich um das Fahrzeug handle, das Oblt. Ulmer zur Vernehmung abholen soll, wird der Wagen ohne Einspruch des Sprengkommandoführers durchgelassen. Uffz. Schneck beobachtet noch, wie geraume Zeit später, nach heftigen Meinungsverschiedenheiten, sich die Soldaten des Sprengkommandos in Richtung Reutlinger Straße entfernen. [3]
Es wird hier zwar ein „glücklicher Zufall“ als Rettungsumstand angegeben, trotzdem wird Dr. Dobler als der hauptsächliche „Widerständler“ hervorgehoben. Wie genau die Entscheidung, die Brücke doch nicht zu sprengen, unter dem immer noch anwesenden Sprengkommando zustande kam, wird in diesem Augenzeugenbericht nicht klar: die Meinungsverschiedenheiten werden nicht erklärt.[4]
Szenario 2: Verhinderten die Anwohner die Sprengung?
Anlässlich des 20. Jahrestags der Besatzung erschien 1965 ein Artikel, der sich auf Berichte von Tübinger Bürger*innen berief. Er verneinte die zentrale Rolle Dr. Doblers und führte die Rettung der Eberhardsbrücke stattdessen auf unterschiedliche Umstände zurück: Einerseits hätte der Tübinger Kampfkommandant Oberst Schütz sich geweigert, den Sprengbefehl bis Mitternacht tatsächlich zu geben, da er aufgrund eines in dieser Nacht für ihn eingegangenen Todesurteils untergetaucht war. Als mögliche Gründe dafür werden in dem Artikel ebenfalls Weigerung zur Sprengung und der Verteidigung Tübingens angegeben; hier wird also eine ähnliche Narration wie bei dem anfangs dementierten Heldentum Dr. Doblers angeboten. Andererseits führt der Artikel die Rettung der Brücke hauptsächlich auf den Widerstand einzelner Anwohner*innen zurück. Sie hätten so lange auf die Soldaten des Sprengkommandos eingeredet, bis diese sich in das Lokal „Zur Neckarbrücke“ zum Trinken zurückzogen, anstatt die angeblich völlig überdimensionierten Sprengladungen zu zünden. Außerdem habe ein Anwohner beobachtet, dass die Zündschnur durchgeschnitten war. Wer den Schnitt gesetzt hatte, gab der Bericht nicht an.[5] Interessant ist an diesen beiden Artikeln vor allem, dass die Widerständler namentlich mehrfach erwähnt wurden, die auf Befehlen beharrenden Nationalsozialisten aber anonym blieben. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Tübinger Bürger*innen zehn Jahre nach Aufhebung des Besatzungsstatuts Verdienste eines Widerstands positiv hervorheben wollten, wohingegen die Namen der Soldaten zu deren Schutz nicht angegeben worden waren.
Szenario 3: Keine Sprengung aufgrund einer Vesperpause?
Eine dritte Version der Rettung der Eberhardsbrücke lieferte der besagte Tübinger Kommandant Oberst Schütz selbst. Jahre später behauptete er, den Zeitpunkt der Sprengung durch Ablenkung mit der Sprengung kleinerer Brücken hinausgezögert zu haben, bis die französische Armee anrückte. Stattdessen habe er Brückenwachen eingesetzt.[6] Das deckt sich mit der Behauptung aus dem Tagblatt-Artikel von 1965, der für die Aktionen Schütz‘ keine Quellen angab. Dem widerspricht allerdings der Journalist Hermann Werner in seiner Jahreschronik zu 1945 direkt: Schütz habe noch im Anmarsch der Franzosen lautstark die Sprengung der Brücke verlangt.[7] Schütz‘ Leutnant Adjutant Rüdiger Hoffmann berichtete wiederum, die verantwortlichen Pioniere hätten im Hotel Goldenen Ochsen beim Vespern gesessen, anstatt die Brücke zu sprengen. Sie seien davon ausgegangen, Tübingen werde noch von einer anderen Schützenkompanie verteidigt.[8]
Auf diesem letzten Bericht basiert eine weitere im Internet und in einem Fotoband zu findende Tübinger Variante.[9] Demnach habe der Wirt des Hotels Goldener Ochse (am heutigen Standort des Bekleidungsgeschäfts Zinser, südlich der Eberhardsbrücke) das Sprengkommando mit einem schwäbischen Vesper so lange abgelenkt, bis die Franzosen eingetroffen seien.[10] Dies lässt sich allerdings nicht verifizieren und wird mit keinem Wort in beiden Artikeln des Schwäbischen Tagblatts von 1945 und 1965 erwähnt.
Legende(n) oder Wahrheit?
Keine dieser drei Versionen lassen sich anhand von Quellen eindeutig belegen, da diese sich widersprechen. Hier kommt man nur mit Quellenkritik und Wahrscheinlichkeitsabwägungen weiter. Es muss bedacht werden, dass alle diese Quellen in der Nachkriegszeit verfasst wurden, als es darum ging, sich in ein positives Licht zu setzen und daher Widerstand gegen den gerade erst überwundenen Nationalsozialismus hervorzuheben.
Alle Quellen stammen allerdings darin überein, dass es Widerstand gegen die Sprengung gegeben habe. Denkbar ist, dass diese Varianten erst im Kontext der französischen Besatzung entstanden, um eine Personengruppe positiver und als Helden darzustellen – seien es Dr. Dobler und seine Vertrauten oder aber Anwohner der Neckarbrücke. Zweifellos ist etwas in jener Nacht geschehen, so dass die Eberhardbrücke trotz Befehl nicht gesprengt wurde. Obwohl die NSDAP-Spitze einen eindrücklichen Verteidigungsbefehl erlassen hatte, wurde Tübingen kampflos an die Franzosen übergeben, wodurch das Schicksal der Brücke untrennbar mit dem der Stadt verbunden ist. So eng Tübingen im „Dritten Reich“ mit dem Nationalsozialismus verbunden war, so bezeichnend ist es, dass sich die teils wenig glaubhaften Erklärungen für das Erhalten der Brücke alle um aktiven und lokalen Widerstand gegen die Wehrmacht drehen – in einer Situation, in der Widerstand mit der Todesstrafe geahndet wurde.
Ein Beitrag von Sandra Höhn
Abbildungsverzeichnis
*Herkunft/Rechte: Haus der Geschichte Baden-Württemberg / Sammlung Gebrüder Metz (CC BY-NC-SA), URL: https://bawue.museum-digital.de/object/29374 (26.4.2025).
Quellen
Hoffmann, Rüdiger: Alles im Eimer, Leutnant Adjutant des Standortältesten und Sicherheitsbereichskommandeurs von Tübingen, Oberst Schütz. In: Werner, Hermann: Tübingen 1945. Bearbeitet und mit einem Anhang versehen von Manfred Schmid, Beiträge zur Tübinger Geschichte Band 1, Tübingen 1986, S. 203.
Schütz, Wolfgang: Bericht über meine Tätigkeit. In: Hermann Werner: Tübingen 1945. Bearbeitet und mit einem Anhang versehen von Manfred Schmid, Beiträge zur Tübinger Geschichte Band 1, Tübingen 1986, S. 227.
Wie unsere Neckarbrücke vor der Zerstörung bewahrt wurde – Auszüge aus einem Augenzeugenbericht. Schwäbisches Tagblatt, 1. Jg., Nr. 5, 5. Oktober 1945, S. 3.
Der Schnaps hat sich gelohnt. Schwäbisches Tagblatt, Jg. 21, Nr. 89, 17. April 1965, S. 14.
Literatur
Moersch, Karl; Baum, Herbert (Hrsg.): Die Zeit nach dem Krieg: Städte im Wiederaufbau. Schriften zur politischen Landeskunde Baden-Württembergs, Bd. 37, Stuttgart 2008, S. 369-398.
Schönhagen, Benigna: Tübingen als Landeshauptstadt 1945-1952 – So viel Anfang war nie, in: Moersch, Karl; Weber, Reinhold (Hrsg.): Die Zeit nach dem Krieg. Städte im Wiederaufbau, Stuttgart 2008, S. 369–398.
Sannwald, Wolfgang (Hsg.): Einmarsch - Umsturz – Befreiung? Das Kriegsende im Landkreis Tübingen Frühjahr 1945, Tübingen 1995.
Schwelling, Michael: Erinnerungen an Tübingen wie es einmal war, Kassel 2001.
Werner, Hermann: Tübingen 1945 - Eine Chronik. Bearbeitet und mit einem Anhang versehen von Manfred Schmid, Beiträge zur Tübinger Geschichte Band 1, Stuttgart 1986.
Fußnoten
[1] Vgl.: Timm, Elisabeth: Tübingen – Als komme ein „Riesenzirkus“ in die Stadt. In: Sannwald, Wolfgang (Hsg.): Einmarsch – Umsturz – Befreiung. Das Kriegsende im Landkreis Tübingen Frühjahr 1945, Tübingen 1995, S. 195-202, hier: S. 195.
[2] Vgl. Der Schnaps hat sich gelohnt. Schwäbisches Tagblatt Südwestpresse, 21. Jg., Nr. 89, 17. April 1965, S. 14.
[3] Wie unsere Neckarbrücke vor der Zerstörung bewahrt wurde – Auszüge aus einem Augenzeugenbericht. Schwäbisches Tagblatt, Südwestpresse, 1. Jg., Nr. 5, 5. Oktober 1945, S. 3.
[4] Vgl. Wie unsere Neckarbrücke vor der Zerstörung bewahrt wurde – Auszüge aus einem Augenzeugenbericht. Schwäbisches Tagblatt, Südwestpresse, 1. Jg., Nr. 5, 5. Oktober 1945, S. 3.
[5] Vgl. Der Schnaps hat sich gelohnt. Schwäbisches Tagblatt Südwestpresse, 21. Jg., Nr. 89, 17. April 1965, S. 14.
[6] Schütz, Wolfgang: Bericht über meine Tätigkeit. In: Hermann Werner: Tübingen 1945. Bearbeitet und mit einem Anhang versehen von Manfred Schmid, Beiträge zur Tübinger Geschichte Band 1, Tübingen 1986, S. 227.
[7] Vgl.: Sannwald: Einmarsch, S. 198.
[8] Hoffmann, Rüdiger: Alles im Eimer, Leutnant Adjutant des Standortältesten und Sicherheitsbereichskommandeurs von Tübingen, Oberst Schütz. In: Werner, Hermann: Tübingen 1945. Bearbeitet und mit einem Anhang versehen von Manfred Schmid, Beiträge zur Tübinger Geschichte Band 1, Tübingen 1986, S. 203.
[9] Vgl. Tuepedia-Seite, URL: https://www.tuepedia.de/index.php/Eberhardsbr%C3%BCcke (03.12.2024).
[10] Schwelling, Michael: Erinnerungen an Tübingen wie es einmal war, Kassel 2001, S. 11; der Fotoband hat keine Fußnoten, womit sich nicht mehr nachvollziehen lässt, wo Schelling diese Geschichte her hat. Erwähnt wird diese von Schelling abgedruckte Geschichte von Sannwald: Einmarsch, S. 199.
Infospalte
Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?
Professoren im Zwielicht? Studentische Auseinander-setzung mit der NS-Vergangenheit
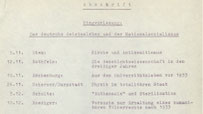
Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Blogreihe: „Zwischen Verdrängen und Erinnern: Tübingens Umgang mit dem Nationalsozialismus“
Kennen Sie schon... ?
Verwandte Themen:




Kommentar schreiben