Mit ihrem Botanischen Garten ist die Universität Tübingen im Besitz einer Lebendsammlung heimischer und global zusammengetragener Pflanzen, deren Akquise bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht – und ist damit nicht alleine. Mit den europäischen „Entdeckungsfahrten“ begann eine lange Geschichte europäischer Aneignung von Botanik. Europäische Gelehrte wie Leonhart Fuchs (1501–1566) in Tübingen und Ulisse Aldrovandi (1522–1605) in Bologna begannen, Naturalien systematisch zu verzeichnen und zu sammeln. Über Pflanzentransfers, Klassifikationen und Züchtungen wurden die Gärten, wie ihre Universitäten, zu Akteuren eines botanischen Imperialismus.

Es ist das Jahr 1542 und am Tübinger Nonnenhaus erblüht in einem kleinen Rondell ein botanischer Lehr- und Heilpflanzengarten. Angelegt hat ihn Leonhart Fuchs, der erst wenige Jahre zuvor (1535) als Medizinprofessor an die Universität berufen wurde. Vor seinem Wohnhaus, in dem zuvor die Tübinger Beginen lebten, liegt damit der erste botanische Garten Tübingens, und einer der frühestens ganz Nordeuropas.[1]
Alte und „neue“ Heilpflanzen
Die Botanik war damals noch eine Hilfswissenschaft der Medizin,[2] und Fuchs hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die in der Antike bekannten Heilpflanzen wieder ins Bewusstsein der mittelalterlichen Medizinlehre zu rufen, und um weitere bislang unerforschte heimische Arten zu ergänzen. Er war bekannt dafür, selbständig und mit studentischen Exkursionen die Gegend um Tübingen und den Schönbuch zu untersuchen, und entdeckte dabei Pflanzen wie den Fingerhut und dessen pharmazeutisches Potential.[3]
1543 erschien in allgemein verständlicher Sprache das New Kreüterbuch von Fuchs, womit das Wissen um die heimische Flora in breitere Bevölkerungsschichten gelangen sollte.[4] Das Besondere an diesem Buch sind jedoch die ganzseitigen, farbigen Holzschnitte, die die Pflanzen von Wurzel zu Knospe und von Blüte zu Frucht zeigen. Leonhart Fuchs gilt heute als Pionier der Botanik und Heilpflanzenlehre in Europa. Mit der an ihn erinnernden „Fuchsie“ ist sein Name auch untrennbar mit der Pflanzenwelt verbunden.[5] Gleichzeitig verweist die Benennung einer in Mittel- und Südamerika und Ozeanien beheimateten Pflanze[6] nach einem deutschen Mediziner auf eine globale Dimension der Botanik – an deren Anfangsphase auch Fuchs mitwirkte. Denn sein Garten bot nicht nur allerlei Arzneipflanzen Raum, sondern umfasste auch „neu entdeckte“ Pflanzen, die von den europäischen „Entdeckungen“ zeugten.[7]
Sein Kräuterbuch enthält naturalistische Abbildungen von mehr als 100 neuen, in Europa noch nie dargestellten Pflanzen. Einige davon stammten aus der „Neuen Welt“, Asien oder Afrika,[8] und wurden, so lassen es die detaillierten Abbildungen und Beschreibungen erkennen, von Fuchs selbst zur Erforschung in seinen Lehrgarten gepflanzt. Für einige beschrieb er eine medizinische Nutzung, er nahm aber auch viele Pflanzen mit noch unbekannter Heilwirkung in sein Kräuterbuch auf, wenn sie erst newlich in unser Teütschland gebracht[9] worden waren. Kräuterbuch und Garten verdeutlichen einen Sammelanspruch, den der Botaniker hier wie die späteren ethnographischen Sammler an den Tag legte, um Vollständigkeit aller existierenden Pflanzenarten bemüht.[10]

Früher botanischer Imperialismus: Die ersten Abbildungen von Mais und Kürbis
1492 stieß Kolumbus auf die Amerikas. Im November desselben Jahres machte er auf dem heutigen Kuba Bekanntschaft mit Maiskolben, die ihm als Geschenk angeboten wurden.[11] Es waren diese so genannten „Entdeckungsreisen“, die auch den Beginn des botanischen Imperialismus markierten. Nicht nur die „Entdecker“ brachten als Zeugnis ihrer Explorationen „fremde“ Flora und Fauna an die Höfe und Universitäten ihrer Auftraggeber*innen; den ersten Schiffen folgten rasch die Händler, und der daraus entstehende Reichtum der Seemächte bildete die materielle Basis für die spätere imperiale Expansion und Konsolidierung der Herrschaft.[12] Genau 50 Jahre nach Kolumbus’ Begegnung wuchs die Maispflanze, gemeinsam mit den ebenfalls amerikanischen Kürbissen, Paprikas und Bohnen im Garten von Leonhart Fuchs in Tübingen.[13] In seinem Kräuterbuch von 1543 ist die erste europäische Abbildung eines Maiskolben zu sehen, und bis heute bringen ihm die Darstellungen einen Ehrenplatz unter den Botaniker*innen ein.[14] Doch der Name verwundert: Warum hießen die Pflanzen „Türkisch Korn“ und „Türkisch Cucumer“? War er sich über ihre eigentliche Herkunft nicht im Klaren? Fuchs erklärt für den Kürbis: Das ander geschlecht würt Türckischer Cucumer genent darumb / on zweifel / das dis gewechs erstlich aus der Türckey ist in unser land kommen.[15] Von Türckischem Korn, schreibt Fuchs, das gewechs ist auch newlich aus der Türckey/Asia und Griechenland zu uns gebracht worden / darumb es Türckisch Korn genent würdt. Der Mais hatte sich rasch etabliert, er war wohl bekömmlich, darumb sie nun fast gemein seind / und in vilen gaerten gezilt werden.[16]Das Kräuterbuch zeigt, dass Fuchs den Kürbis in die Familie der Gurkengewächse einzuordnen wusste, und vom Mais bereits vier verschiedene Sorten bekannt waren. Auch das frembd gewechs[17] Paprika säte er unbekannterweise selbst an, wobei er rasch bis zu vier Sorten gezüchtet hatte.[18] Es handelt sich hierbei um frühe Beispiele globalen Pflanzentransfers, der Anlegung einer europäischen Perspektive und Wissenspraktik auf die aus anderen Kulturen und Wissenszusammenhängen herausgelöste Botanik sowie der europäischen Zucht außereuropäischer Nutzpflanzen, die später wichtige Säulen der kolonialen Wirtschaft werden sollten. Koloniale Kontinuitäten beschäftigen daher nicht nur Museen, sie sind auch in Botanischen Gärten sichtbar.
Mais war als Nutzpflanze rasch zu einem Hauptinteresse der transatlantischen Reisenden und Forscher geworden. Bereits 1525 wuchsen in Spanien die ersten Maisfelder. Nach Deutschland kam der Mais aber noch aus einer anderen Richtung: Die Portugiesen hatten mittlerweile eine Handelsroute zwischen den Amerikas und Indien etabliert und der Maisanbau hatte spätestens 1517 bereits China erreicht.[19] Es war der Beginn einer Entwicklung, die die Maispflanze bis ins 20. Jahrhundert zu einer Chiffre der globalen wirtschaftlichen Ausbeutung machen sollte.[20] Für Fuchs war es daher zunächst nachvollziehbarer Weise schwer, die Herkunft der Pflanze richtig einzuordnen. Alle drei Pflanzen – Mais, Paprika und Kürbis – kamen nicht direkt über den Seeweg und Italien nach Tübingen, sondern über den portugiesischen Handel mit Indien und den asiatischen Landweg.

Nachgeschichte: Die Tübinger Orangerie
Fuchs’ anfänglicher Kräuter- und Gemüsegarten wurde, nach einem Intermezzo an der Alten Aula, 1805 an der Ammer neu angelegt. Zu den ersten dort gezogenen Baumsorten gehörten Arten aus China und Nordamerika, wie Ginkgo oder Tulpenbaum, letzterer sollte zur gleichen Zeit auch von städtischer Seite mehrfach gepflanzt werden.[21] Der Wettlauf um die meisten und „exotischsten“ Pflanzen ging weiter, sie waren nicht nur zum Instrument, sondern zum Symbol der Entdeckung, Vereinnahmung und Beherrschung der Welt durch Europa geworden.[22] In gleicher Manier orientierte sich auch das 1886 errichtete „Palmenhaus“, ein weitläufiges Gewächshaus an der Längsseite des Gartens, an den von den Weltausstellungen des 19. Jh. bekannten gläsern-gusseisernen Hallen.[23] Es ermöglichte nicht nur den Import und die Zucht tropischer Bäume, sondern war auch architektonisches Symbol des nationalen Fortschritts- und Herrschaftsanspruchs in der Welt. In Tübingen war das Haus als „Orangerie“ bekannt; im 19. Jh. war der Glanz dieser klassischen Zitrusgartenhäuser des europäischen Adels bereits verblasst – nostalgisch klingt in der von den Tübinger*innen fortgeführten Bezeichnung die Symbolik der antiken und frühneuzeitlichen Orangerien nach: Zitrusbäume standen für die Wiederkehr eines Goldenen Zeitalters adeliger Herrschaft.[24] Gleichzeitig wurden die gläsernen Gartenpaläste mit neuer Bedeutung aufgeladen: Botanische Gärten konsolidierten die modernen Imperien, und Orangerien waren ihr technisch-architektonisches Symbol.[25]
Der Umzug des Gartens auf die Morgenstelle Ende der 1960er Jahre fällt in eine Zeit der Neuorientierung der europäischen Botanischen Gärten. Der Einfluss der Umweltbewegung machte sich schon darin bemerkbar, dass die alte Symbolkraft der Gärten schwand und sie sich mehr auf Biodiversität und Artenschutz verlagerten.[26]
Heute zeigt der Alte Botanische Garten nur noch wenige Spuren dieser imperialen bis kolonialen Vergangenheit. Das Palmenhaus ist längst abgerissen, aber einige Zeugen sind noch im Park verwurzelt: Ginkgo und Tulpenbaum werden seit 2022 im kolonialen Stadtrundgang des Stadtmuseums thematisiert. Die Sammlung selbst lebt im Neuen Botanischen Garten weiter. Da Tübingen nicht die einzige Stadt mit schwerem botanischem Erbe ist, lohnt sich ein Blick nach außen: Universitäten wie Bonn und Potsdam bieten bereits postkoloniale Ausstellungen und Führungen durch ihre Gärten und Sammlungen an und profitieren von Studierendenprojekten zu kolonialen Kontinuitäten in der Botanik.[27] Die Botanischen Gärten Europas und ihre Institutionen befinden sich erneut in einer formativen Phase; sie werden sich eigener Verantwortung bewusst, loten aus, wie sich postkoloniale Perspektiven anlegen lassen und werden zu Akteur*innen der Dekolonisierung.[28]
Leonhart Fuchs und sein Lebenswerk lassen sich gleichzeitig als Phänomen der europäischen Renaissance, sowie als Beispiel der zunehmend global orientierten Botanik nördlich der Alpen begreifen. Eine Natursammlung anderer Art legte sein Kollege Ulisse Aldrovandi im 16. Jahrhundert in Bologna an. Er gilt ebenso wie Fuchs als Gründer des Botanischen Gartens seiner Universität – und mit seinen Herbarien, Büchern und Sammlungen als Begründer der modernen europäischen Naturforschung. Inwieweit sich südlich der Alpen parallele und partikulare Entwicklungen beobachten lassen, zeigt der nächste Woche erscheinende Beitrag Glokale Botanik 2: Tübingen, Bologna: Von Kreüterbuch und Naturalienkabinett.
Ein Beitrag von Vera Brillowski
Fußnoten:
[1] Vgl. Dilg, Peter: Leonhart Fuchs. Arzt – Botaniker – Humanist, in: Köpf, Ulrich; Lorenz, Sönke; Bauer, Dieter R. (Hg.): Die Universität Tübingen zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg, Ostfildern 2010, S. 235–248, S. 245 und Dobat, Klaus: Ein blühendes Forschungsfeld. Der Fuchs’sche Garten beim Nonnenhaus, in: Brinkhus, Gerd; Pachnicke, Claudine (Hg.): Leonhart Fuchs (1501–1566). Mediziner und Botaniker, Tübingen 2001, S. 113–120, S. 119.
[2] Vgl. Dilg: Leonhart Fuchs, S. 244.
[3] Vgl. Dobat, Klaus: Grundlagenforschung für die Botanik. Die Kräuterbücher des Leonhart Fuchs, in: Brinkhus, Gerd; Pachnicke, Claudine (Hg.): Leonhart Fuchs (1501–1566). Mediziner und Botaniker, Tübingen 2001, S. 85–112, S. 85
[4] Vgl. Dilg: Leonhart Fuchs, S. 246.
[5] Vgl. Rothfuß, Stefan: Die Arzneimittellehre in den Werken des Leonhart Fuchs, in: Friedrich, Christoph; Mönnich, Michael (Hg.): Pharmazie in Tübingen. Vorträge des Pharmaziehistorischen Vorsymposiums der DPhG-Jahrestagung am 7. Oktober 2023 in Tübingen, Marburg 2024, S. 73–95, S. 73.
[6] Vgl. Dilg: Leonhart Fuchs, S. 247.
[7] Vgl. Dobat: Grundlagenforschung, S. 109.
[8] Vgl. ebd., S. 96.
[9] Fuchs, Leonhart: New Kreüterbuch, 1543, Kap. CCLXXXI.
[10] Vgl. Dobat: Grundlagenforschung, S. 97.
[11] Vgl. ebd., S. 104.
[12] Vgl. Broswimmer, Franz: Botanical Imperialism. The Stewardship of Plant Genetic Resources in the Third World, in: Critical Sociology 18 (1991) 1, S. 3–17, S. 6 und Neves, Katja: Botanic Gardens in Biodiversity Conservation and Sustainability: History, Contemporary Engagements, Decolonization Challenges, and Renewed Potential, in: Journal of Zoological and Botanical Gardens 5 (2024) 2, S. 260–275, S. 263.
[13] Vgl. Dobat: Grundlagenforschung, S. 105.
[14] Vgl. Dilg: Leonhart Fuchs, S. 247.
[15] Fuchs: New Kreüterbuch, Kap. CCLVII.
[16] Ebd., Kap. CCCXX.
[17] Ebd., Kap. CCLXXXI
[18] Vgl. Dobat: Grundlagenforschung, S. 106 und Fuchs: New Kreüterbuch, Kap. CCLXXXI.
[19] Vgl. Dobat: Grundlagenforschung, S. 105.
[20] Vgl. Broswimmer: Botanical Imperialism, S. 5f.
[21] Vgl. Krekeler, Marlene: Kolonialgeschichte lokal und greifbar. Ginkgo-Blätter beim Stadtrundgang „Koloniale Orte“, in: Historischer Augenblick, 09.02.2023, online: https://www.historischer-augenblick.de/2023/02/09/kolonialgeschichte-lokal-und-greifbar-ginkgo-bl%C3%A4tter-beim-stadtrundgang-koloniale-orte/ (16.07.2025) und Stadtarchiv Tübingen, StATb A-73, Rechnung über den Kauf von Platanen, 28.01.1828.
[22] Vgl. Brockway, Lucile: Science and Colonial Expansion. The Role of the British Royal Botanic Gardens, in: American Ethnologist 6 (1979) 3, S. 449–465, S. 461, FN 4 und Koloniale Orte in Tübingen: Grünes Gold im Botanischen Garten, online: https://www.koloniale-orte-tuebingen.de/ (16.07.2025).
[23] Vgl. ebd.
[24] Siehe Paulus, Helmut-Eberhard: Orangerieträume in Thüringen, Regensburg 2005.
[25] Vgl. Neves: Botanic Gardens, S. 261.
[26] Vgl. ebd.
[27] Vgl. Botanischer Garten der Universität Potsdam: Koloniale Kontinuitäten. Postkolonialer Rundgang durch den Botanischen Garten Potsdam, Dauerausstellung, 26.08.2023, online: https://www.uni-potsdam.de/de/botanischer-garten/unser-garten/kolonialismus (16.07.2025).
[28] Vgl. Neves: Botanic Gardens, S. 262.
Quellen:
Fuchs, Leonhart: New Kreüterbuch 1543, Edition von Dobat, Klaus: Leonhart Fuchs. The New Herbal, New Kreüterbuch, 1543, Köln 2001.
Stadtarchiv Tübingen, StATb A-73, Rechnung über den Kauf von Platanen, 28.01.1828.
Literatur:
Botanischer Garten der Universität Potsdam: Koloniale Kontinuitäten. Postkolonialer Rundgang durch den Botanischen Garten Potsdam, Dauerausstellung, 26.08.2023, online: https://www.uni-potsdam.de/de/botanischer-garten/unser-garten/kolonialismus (16.07.2025).
Brockway, Lucile: Science and Colonial Expansion. The Role of the British Royal Botanic Gardens, in: American Ethnologist 6 (1979) 3, S. 449–465.
Broswimmer, Franz: Botanical Imperialism. The Stewardship of Plant Genetic Resources in the Third World, in: Critical Sociology 18 (1991) 1, S. 3–17.
Dilg, Peter: Leonhart Fuchs. Arzt – Botaniker – Humanist, in: Köpf, Ulrich; Lorenz, Sönke; Bauer, Dieter R. (Hg.): Die Universität Tübingen zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg, Ostfildern 2010, S. 235–248.
Dobat, Klaus: Grundlagenforschung für die Botanik. Die Kräuterbücher des Leonhart Fuchs, in: Brinkhus, Gerd; Pachnicke, Claudine (Hg.): Leonhart Fuchs (1501–1566). Mediziner und Botaniker, Tübingen 2001, S. 85–112.
Dobat, Klaus: Ein blühendes Forschungsfeld. Der Fuchs’sche Garten beim Nonnenhaus, in: Brinkhus, Gerd; Pachnicke, Claudine (Hg.): Leonhart Fuchs (1501–1566). Mediziner und Botaniker, Tübingen 2001, S. 113–120.
Koloniale Orte in Tübingen: Grünes Gold im Botanischen Garten, online: https://www.koloniale-orte-tuebingen.de/ (16.07.2025).
Krekeler, Marlene: Kolonialgeschichte lokal und greifbar. Ginkgo-Blätter beim Stadtrundgang „Koloniale Orte“, in: Historischer Augenblick, 09.02.2023, online: https://www.historischer-augenblick.de/2023/02/09/kolonialgeschichte-lokal-und-greifbar-ginkgo-bl%C3%A4tter-beim-stadtrundgang-koloniale-orte/ (16.07.2025)
Neves, Katja: Botanic Gardens in Biodiversity Conservation and Sustainability: History, Contemporary Engagements, Decolonization Challenges, and Renewed Potential, in: Journal of Zoological and Botanical Gardens 5 (2024) 2, S. 260–275.
Paulus, Helmut-Eberhard: Orangerieträume in Thüringen, Regensburg 2005.
Rothfuß, Stefan: Die Arzneimittellehre in den Werken des Leonhart Fuchs, in: Friedrich, Christoph; Mönnich, Michael (Hg.): Pharmazie in Tübingen. Vorträge des Pharmaziehistorischen Vorsymposiums der DPhG-Jahrestagung am 7. Oktober 2023 in Tübingen, Marburg 2024, S. 73–95.
Bilder:
*Abb. 1: Leonhart Fuchs, 1941. Quelle: Heinrich Füllmaurer, Public domain, via Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renaissance_C14_F%C3%BCllmaurer_Leonhart_Fuchs.jpg (22.7.2025).
** Abb. 2: Türckisch Korn, Holzschnitt im New Kreüterbuch, 1543. Quelle: Albert Meyer, Public domain, via Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%BCrckisch_Korn_Fuchs_1543_813.jpg (22.7.2025).
*** Abb. 3: Das Gewächshaus im Alten Botanischen Garten, auch "Palmenhaus" oder "Orangerie" genannt, 1960er Jahre. Quelle: K. Göhner (Landesdenkmalamt), CC0, via Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmenhaus_im_Botanischen_Garten_(LDA).jpg (22.7.2025).
Infospalte
Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?
Professoren im Zwielicht? Studentische Auseinander-setzung mit der NS-Vergangenheit

Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Blogreihe: „Zwischen Verdrängen und Erinnern: Tübingens Umgang mit dem Nationalsozialismus“
Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Akteure der Anatomie-geschichte. Die „Entgrenzte Anatomie" rezensiert
Kennen Sie schon... ?
Kennen Sie schon... ?
Verwandte Themen:


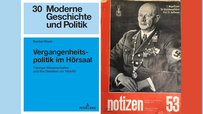




Kommentar schreiben